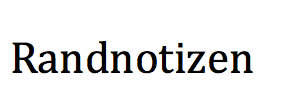|
| François Ozon |
Marcus Seibert: Wie machen Sie das, jedes Jahr einen Film zu drehen?
François Ozon: Ich liebe meine Arbeit, folge also vor allem meinem Vergnügen, wenn ich drehe. Es gibt eine Reihe Filmemacher, die leiden beim Drehen. Ich gehöre nicht dazu. Außerdem habe ich zum Glück nie Probleme gehabt, mich von Themen inspirieren zu lassen. Die findet man überall, muss man nur die Augen offen haben und sich umsehen. Das Problem besteht eher darin, einschätzen zu können, was sich umzusetzen lohnt. Aber wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich zwei oder drei Filme im Jahr drehen, wie Fassbinder. Nur leider muss ich ja zwischendurch, wie jetzt für „Dans la maison” („In ihrem Haus”), auch auf Werbetour gehen.
MS: Sie haben Fassbinder erwähnt und beziehen sich oft auf diesen deutschen Filmemacher. Wie kommt dieser Bezug zustande?
FO: Ich konnte mich als Student nie auf eine Art Kino festlegen und fühlte mich von sehr verschiedenen Filmen angezogen. Zwischen all den anderen Studenten, die genau wussten, was sie später machen wollten, habe ich mich mit meinen gegensätzlichen Vorlieben verloren gefühlt. Fassbinders Filme haben mich bestätigt und von dem Druck befreit, mich entscheiden zu müssen. Da war jemand, der völlig frei von Zwängen auftrat, vor nichts Angst hatte und Genres mischte, wie es ihm gefiel. In seinem Werk findet man Sozialdramen, Komödien, Melodramen und immer wieder extrem stilisierte, theatralische Filme. Mich hat diese Vielfalt begeistert, die unerschöpfliche Energie, die Arbeit in einer Art Schauspielerfamilie.
MS: Sie haben eines seiner Theaterstücke adaptiert, „Tropfen auf heiße Steine”.
FO: Ja. Er war siebzehn, als er das geschrieben hat. Mich hat die Reife des Stücks begeistert, diese Hellsichtigkeit, was Paare und Liebesbeziehungen anbelangt. Eigentlich wollte ich das Stück ja gar nicht verfilmen. Ich war gerade selbst dabei, einen Stoff über ein Paar zu schreiben, eine Liebesgeschichte. Aber dann habe ich „Tropfen auf heiße Steine” im Theater gesehen. Das war genau das, was ich schreiben wollte. Da habe ich dann lieber gleich das Stück adaptiert.
MS: Durch die Übersetzung haben Sie dem Fassbinder-Text zu einer Leichtigkeit verholfen, die seine Diktion auf Deutsch nicht hat.
FO: Auf Französisch klingt das immer noch ziemlich künstlich. Aber das war mir egal. Ich mochte dieses Stück. Ich mag es immer noch. Was übrigens diese Künstlichkeit von Übersetzungen anbelangt, so spürt man die auch in Filmen wie „Amour” von Michael Haneke zum Beispiel.
MS: Das Drehbuch wurde von einem französischen Drehbuchautor übersetzt.
FO: Klingt aber eben übersetzt, auch im Stil, wie sich die Figuren äußern.
MS: Sie haben seit dem Fassbinder-Film eine Menge Theaterstücke verfilmt. Theater ist ja für viele eher der Feind des Kinos.
FO: Für mich war das noch nie so. Ich liebe das Theatralische im Film. Viele Regisseure wollen das im Film möglichst zurückdrängen, aufgrund der Kinotradition, die sich vom Theater erst mal absetzen musste. Mir macht das keine Angst. Vielleicht ist das meine Brecht’sche Seite. Ich liebe
Verfremdungseffekte und finde es immer wichtig, dass der Zuschauer nicht vergisst, dass er einen Film sieht. Ich mag diese reflexiven Moment und einen gewissen Abstand in der Erzählweise.
MS: Es ist also für Sie bereits eine Verfremdung, aus einem Theaterstück einen Film zu machen.
FO: Nicht unbedingt. Das hängt von der Adaption ab. Ich habe schon Filme gedreht, wo ich die Theatervorlage eins zu eins umgesetzt habe, zum Beispiel bei „Tropfen auf heiße Steine” oder „Acht Frauen”. Diese Filme spielen mit der Idee des Theatralischen, die immer ein Element des Films gewesen ist. In meinem letzten Film, „In ihrem Haus” habe ich eher versucht, gegen den theatralischen Aspekt des Stückes zu arbeiten und eine filmische Umsetzung zu finden, der man das Theaterstück nicht mehr anmerkt.
MS: Aber am Ende des Films schließt sich wieder ein Vorhang...
FO: ...weil das Leben eine Bühne ist, auf der wir die Darsteller sind, wenn Sie so wollen. Wir alle tragen Masken. Das ist doch die Wirklichkeit.
 |
| Ein Bild aus DANS LA MAISON (F 2012). |
MS: Wie sind sie auf das Stück von Mayorga gekommen. Haben Sie seinerzeit die Inszenierung im Théâtre de la Tempête gesehen?
FO: Ja. Ich werde ziemlich oft von Schauspielern gebeten, mir ihre Stücke im Theater anzusehen. Ich hab im Allgemeinen nicht viel Lust dazu, aber in diesem Fall hat eine Freundin von mir so lange nachgehakt und der Titel des Stücks „Der Junge aus der letzten Reihe” gefiel mir so gut, dass ich schließlich doch hingegangen bin. Und als ich das Stück gesehen habe, war mir sofort klar, das ist was für mich. Es geht um einen frustrierten Literaturlehrer, den ein Schüler dazu bringt, wieder Spaß am Erfinden von Geschichten zu bekommen. Das war noch, bevor ich „Das Schmuckstück” gedreht habe.
MS: Es gibt in ihren Filmen zahlreiche abgeschlossene Räume oder Häuser als Protagonisten, zahlreiche Kammerspiele.
FO: Mein Vater war Wissenschaftler. Er machte immer wieder kleine Experimente mit Mäusen und Fröschen. Ich bevorzuge es, die Figuren zusammen einzuschließen und zu sehen, was passiert.
MS: Im Theaterstück von Mayorga werden die Aufsätze des Schülers vorgelesen. Das haben Sie geändert.
FO: Sie haben das Stück gelesen? Im Original?
MS: In der französischen Fassung. Sie haben die im Stück rezitierten Texte großenteils in Off-Texte zu stummen Szenen verwandelt.
FO: Ja, ich musste das visualisieren, was im Theater über Dialog oder Monolog abgewickelt wird. Im Kino kann eine Seite Dialog durch einen Blick, eine Einstellung, eine Kamerabewegung dargestellt werden. Das ist ein Vorteil. Und es hat mich bei diesem Film besonders gereizt, zu allen Formelementen, die im Theater funktionieren, eine Kinoentsprechung zu finden. Die Amerikaner hätten aus der Vorlage ganz sicher einen Thriller gemacht, der komplett in dem Haus spielt, wo dann auch alle wichtigen Ereignisse stattfinden. Aber mich hat genau das Gegenteil interessiert: Es passiert nur Alltägliches, banale alltägliche Probleme werden gezeigt und das Interesse des Zuschauers gilt weniger dem, was als nächstes geschehen wird, als vielmehr der Frage, wie diese Alltäglichkeiten erzählt werden. Die Erzählweise interessiert mehr als das Erzählte.