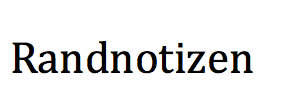Man könnte meinen, die Welt der Kindergeschichten hätte ein Problem mit Frauen, die nur in Gestalt von Stiefmüttern zugelassen scheinen. Aber das Phänomen ist wohl eher eine Folge der Dramaturgie, nach der zum Heldentum die Besonderung und Entwurzelung gehört, die in ihrer extremsten, sofort überzeugenden Form auch heute noch Mutterlosigkeit heißt. Auch wenn die Zahl der sich um ihre Kinder kümmernden Väter zugenommen haben soll, man spricht immer noch von abwesenden Vätern, die entweder viel oder wochentags in einer anderen Stadt arbeiten, sodass sie ihre Kinder nicht oder nur in Randzeiten sehen. Wochenendväter, allein erziehende Mütter, Patchworkfamilien, bei denen die Kinder meist bei ihren Müttern und Stiefvätern leben.
In den Wunschphantasien der Märchen und Kindergeschichten wird die Rückkehr des kindlichen Helden zum Vater, aber auch die Rückkehr des Vaters zum kindlichen Helden als Erfolgsgeschichte mit glücklichem Ausgang inszeniert, gegenläufig zu den wahrscheinlichen Biografien. Die wahren Heiligenlegenden von Moses über Gregorius bis hin zu Peter Pan und Mowgli kennen jedoch den elternlosen Helden, wie er heute in der Babyklappe abgegeben oder zur Adoption freigegeben würde, als Findelkind im Bastkorb, im Schilf, auf Kirchentreppen oder auf feudalen Landsitzen. Einmal elternlos eingeführt, sind diese Helden völlig frei vom Balast psychologischer Determination, den das Zusammenleben mit ihren Erzeugern nach sich zieht, und können den aberwitzigsten Lebensumständen ausgesetzt werden, durch die hindurch sie aus sich selbst heraus und mit Freundeshilfe ihre besondere Bestimmung finden.
Noch einmal Disney: Es ist schon erstaunlich, was 1967, im Vollbewusstsein des Vietnamkriegs, aus Rudyard Kiplings Dschungelbuch wurde. Was bei Kipling noch als magisch-animistischer Kitsch aufgebaut wurde, um den asiatischen Dschungel als eine Utopie zu beschwören, unter dessen Gesetz das Leben ohne Menschen schöner ist, wird in Hollywood zu militärischem Slapstick. Der Elefant Hati ist hier nicht der weise Älteste der bei Mondlicht tanzenden Tiere, die das Gedächtnis des Urwalds verkörpern, sondern der selbstverliebt schneidige Anführer eines Haufens marschierender Trottel. Auch hier nur Männer. Baghira, Balou, King Louis, Shirkan, die Geier. Die geheime Mission der Hauptfiguren, die auch gut in Uniformen stecken könnten, ist, Mowgli zu der einzig offensiv weiblich, nämlich mit übergroßen Augen und überlangen Wimpern gezeichneten Figur des Films zu bringen: Zu dem Menschenmädchen, dass am Fluss Wasser schöpft. Der Entzug alles Weiblichen, der in Kiplings Roman nicht so angelegt ist, lässt am Ende die Begeisterung Mowglis besser verstehen, macht aber aus dem Dschungel ein Kampffeld undurchsichtiger männlicher Interessen, ein Kriegsgebiet, in dem Frauen nichts verloren haben und dessen Gefährlichkeit durch die Lustigkeit der Slapstick- und Gesangseinlagen, durch die Darstellung echter Kameradschaft kaschiert wird. Die Überlegenheit der Menschen zeigt sich hier, schon in der Romanvorlage, im Einsatz des Feuers, vor dem Mowgli nicht zurückschreckt, um seinen Freund vor dem bösen Tiger zu retten.